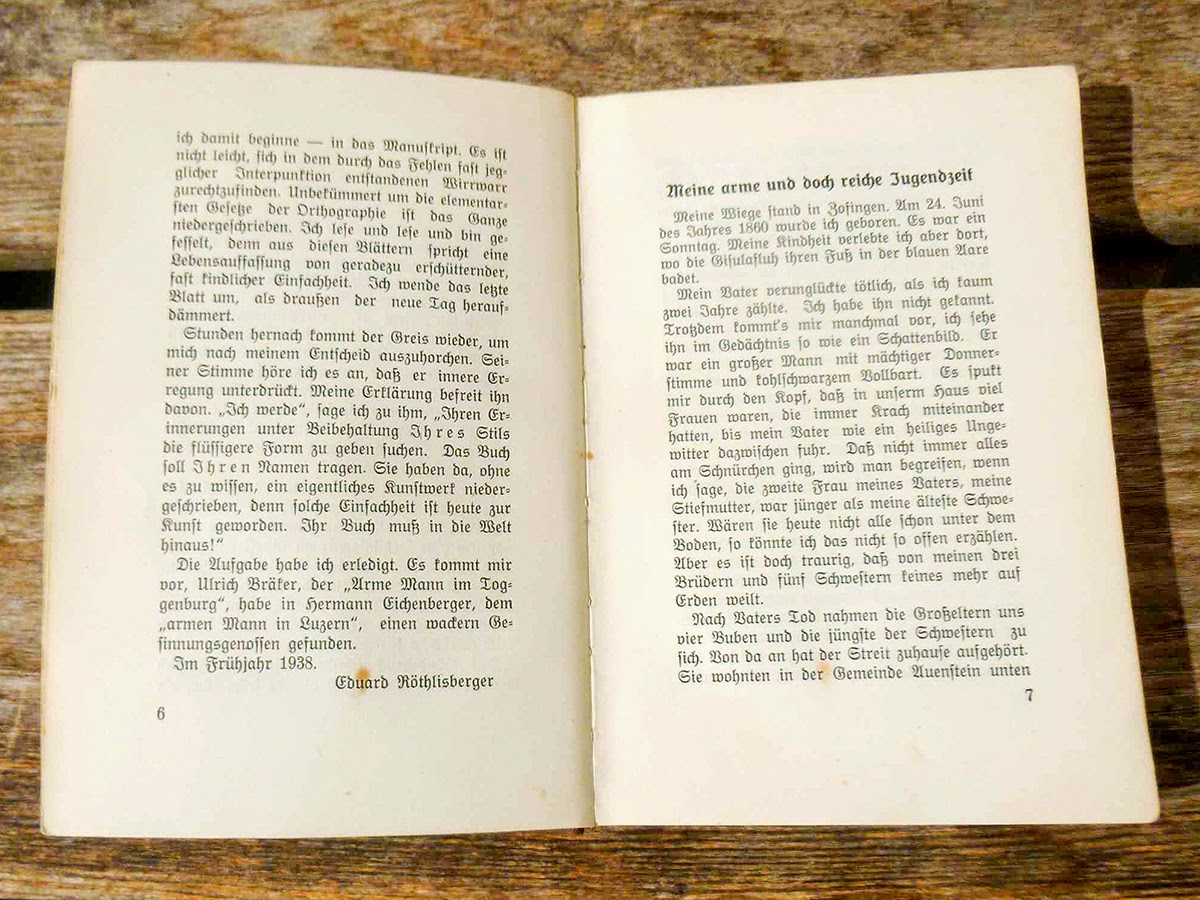Vor ein paar Wochen wurde mir das nur noch antiquarisch käufliche Buch
Von der Aare bis zur Wolga zum Lesen übergeben. Die Lebensbeschreibung eines wandernden Schweizer Handwerkers. 1938 im Verlag
Walter Loepthien, Meiringen und Leipzig, erschienen. Ein Juwel.
Hans Hermann Eichenberger ist der Erzähler der eigenen Lebensgeschichte. Eduard Röthlisberger
bearbeitete seine von Hand geschriebenen Aufzeichnungen. Ob
Röthlisberger der Verleger oder ein Schriftsteller war, ist mir nicht
bekannt.
Er berichtet im Vorwort („Zum Geleit“), vom Besuch „eines Mannes, nahe der Grenze des patriarchalischen Alters“,
der ihm 4 umfangreiche Hefte vorlegte. Er bat um Durchsicht seiner
Erinnerungen und wollte wissen, ob Röthlisberger diese durchlesen und
vielleicht verarbeiten wolle. Viele seiner Bekannten hätten ihn
gedrängt, seine aussergewöhnlichen Erfahrungen aufzuschreiben. Er sei 24
Jahre lang als Handwerksbursche in der weiten Welt herumgekommen.
Geboren wurde er 1860 in Zofingen, Kanton Aargau.
Röthlisberger erwärmt sich nach und nach für diesen alten Mann. Er nennt ihn Greis. Im Vorwort schrieb er: „Mit
Händedruck scheiden wir. Unverzüglich vertiefe ich mich – es ist abends
6 Uhr, als ich damit beginne – in das Manuskript. Es ist nicht leicht,
sich dem durch das Fehlen fast jeglicher Interpunktion entstandenen
Wirrwarr zurechtzufinden. Unbekümmert um die elementarsten Gesetze der
Orthographie ist das Ganze niedergeschrieben. Ich lese und lese und bin
gefesselt, denn aus diesen Blättern spricht eine Lebensauffassung von
geradezu erschütternder, fast kindlicher Einfachheit. Ich wende das
letzte Blatt um, als draussen der neue Tag heraufdämmert."
„Eichenbergers Aufzeichnungen erschienen dann unter Beibehaltung
seines Stils, jedoch in einer flüssigeren Form und unter seinem Namen.“ Röthlisberger begleitete das Kunstwerk dieses Mannes respektvoll in die Welt hinaus.
Schon das Geleitwort strahlt Aussergewöhnliches aus. Es packte mich. Ich las es Primo
vor. Und sofort waren wir uns einig, dass dieses Buch mit seinen 146
Seiten vorgelesen werden muss. So hielten wir es. Die Geschichte wurde
für uns lebendig. Es entstand ein gemeinsames Erlebnis, und wir freuten
uns auch, dass wir die alte deutsche Frakturschrift immer noch
problemlos lesen können.
Alle Erlebnisse sind kurz und bündig, dicht beschrieben und packten
uns in ihrer Einfachheit. Auch wir erwärmten uns für diesen
unerschrockenen, offensichtlich freundlichen und tüchtigen Mann.
Als er auf die Welt kam, waren die Verhältnisse in seiner Familie
alles andere als intakt. Sein Vater starb, noch bevor er 2 Jahre alt
war. Von seiner leiblichen Mutter wird in seinen Aufzeichnungen nicht
gesprochen. Von der Stiefmutter schon. Einer Person, die dem gängigen
Bild der Stiefmütter aus den Märchen entsprach.
Zank und Streit müssen Dauergäste gewesen sein. Nur bei der
Grossmutter fand Eichenberger Liebe und viel Verständnis. Ihr durfte er
alles berichten und seine Anliegen anvertrauen. Umso trauriger dann ihr
Tod. Ein grosser Verlust. Er schrieb dazu: „Am Morgen des Sterbetages
ging der Grossvater ins Dorf, um entsprechend dem Brauch zur Leiche
anzusagen. Der Bruder marschierte derweil nach Wildegg zum Doktor. Ich
legte mich zu der toten Grossmutter ins Bett, hielt ihren Hals
umschlungen, klagte ihr, nun sei ich ganz allein und weinte bitterlich.“
Glück aber brachte ihm der Beruf. Es bot sich die Gelegenheit, eine Lehre als Kupferschmied anzutreten. Mir war das recht, schrieb er.
Freude am Formen und Gestalten, Freude an seinem Beruf, sie
ermöglichten ihm, sich grosse Wünsche zu erfüllen. Schon immer wollte er
in die Welt hinaus, spürte den Drang, sie kennen zu lernen. Sein
berufliches Können unterstützte ihn. So wurde er zum wandernden
Handwerker.
Er arbeitete in der Schweiz, in Italien, Österreich, Ungarn,
Serbien, Rumänien, Polen und Russland. Überall wurde er, wie gerufen,
willkommen geheissen und eingestellt. Überall konnte er wertvolle Arbeit
leisten und wurde als umgänglicher, tüchtiger und auch als sparsamer
Schweizer geschätzt.
St. Petersburg faszinierte ihn ganz besonders. Schon die
Reise dorthin war aussergewöhnlich. Im Nachtzug machte der Schaffner
gegen morgens 4 Uhr auf Wolfsrudel aufmerksam. Diese hatten den Zug
erwartet, weil Reisende hier Knochen und Brot aus den Fenstern werfen.
Eichenberger staunte über den Kampf um diese Nahrung und auch darüber,
wie die Tiere dem etwa 100 Km schnellen Zug nachjagten. Er sprach von
Bestien, die sich rauften und den Artgenossen die Bissen streitig
machten.
4 Tage gönnte er sich, um St. Petersburg kennen zu lernen. Dann
fand er auch hier wieder rasch eine gute Arbeit. Ihn begeisterten in
dieser riesigen Stadt mit ihren 246 Kirchen die weltlichen und
kirchlichen Feiertage. Besonders das Fest der Newa-Weihe -
Segnung des Flusses - bewegte ihn. Er erlebte den Zaren mit der ihn
umgebenden Pracht. Und er fühlte sich wohl unter den russischen
Menschen.
Später in Nischni-Nowgorod wurde ihm dann eines Tages
bewusst, dass er immer nur ein Fremdling gewesen war. Und er entschloss
sich, in die Schweiz, in seine Heimat, zurückzukehren. Aber die Schweiz
sah in ihm, dem Mann mit dem gigantischen Schnurrbart und der
fremdländischen Kleidung, anfänglich wie anderswo, auch einen Fremden.
Nach und nach fand er aber auch hier wieder Freunde und
Geselligkeit. Er lebte auf. Und als er dann eine junge Frau kennen
lernte und begriff, dass eines das andere verstand, heirateten sie. Als
Überraschung für die Braut führte die Hochzeitsreise nach Wien. Dort
feierte man gerade den 1. Mai, und das Hochzeitspaar begegnete dem
Kaiser. Sie hätten Glück gehabt, schrieb er. „Die Kavalkade kam ganz
nahe an unserem Wagen vorüber. Wir hatten uns erhoben. Ich nahm vor
seiner Majestät den Hut in die Hand und verneigte mich. Der Kaiser
salutierte freundlich.“
Seine Frau, die er liebevoll s‘ Müetti nannte, soll darob erschrocken sein. Er kenne den Kaiser doch nicht. – Er aber kannte ihn schon seit Jahren.
Wer kann schon solche Geschichten erzählen?
Vielleicht jener Mann, dem ich vor kurzem in Zürich an der Tramstation Paradeplatz begegnet bin?
Es war später Abend, und nur noch wenige Menschen waren unterwegs.
Auf der überdachten Bank sassen 2 Männer. Ein stiller Schweizer und ein
Mann aus einem fernen, mir unbekannten Land. Der Schweizer hörte zu, was
der Unbekannte erzählte. Dieser sprach ein gut verständliches Deutsch,
doch die Aussprache liess an ein Land im mittleren Osten denken. Er trug
eine vornehme Kleidung, die eine Uniform sein konnte, oder die ihn zu
einem besonderen Volksstamm gehörend auszeichnete.
Wie ich später annahm, hatte der Schweizer diesem Mann vermutlich
den Weg zur Tramstation gewiesen und wartete hier noch, bis das Gefährt
eintraf. Der Paradeplatz ist eine wichtige Umsteigestation. Es kreuzen
sich dort verschiedene Linien. Der Wegweisende wollte sicher sein, dass
der Gast in die richtige Richtung fuhr.
Ich wurde auf die beiden aufmerksam, weil der Unbekannte laut
redete. Ich hörte, wie er dem Wegweisenden erzählte, er habe für seine
Frau eine Flasche Champagner gekauft. Er hielt sie in die Höhe und
verwies noch auf die dazugehörigen Gläser in der Papiertragtasche. Er
öffnete den Reissverschluss seiner grossen Umhängetasche, die aus
demselben khakifarbenen Stoff wie seine Kleidung geschaffen war. War es
eine Uniform oder eine Tracht? Mit Bordüren, speziellen Knöpfen und
Bändern dekoriert. Und nicht zu übersehen, dass sie aus edlem Stoff
geschaffen war. Dieser Tasche entnahm er ein ziseliertes Tablett. Er
wolle es ebenfalls seiner Frau schenken. Sie habe ihm schliesslich 2
Kinder geboren.
Dann fuhr Tram Nr 2 an der Station ein und entführte ihn.
Wer war dieser Fremde? Ein Eichenberger aus der heutigen Zeit? Ich weiss es nicht.